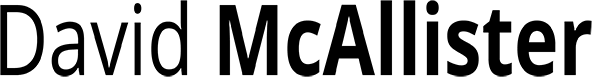Interview in der WELT
WELT: Wenn Sie auf die vergangenen beiden Wochen in London, Berlin oder auch München zurückblicken: Welche politische Entwicklung bereitet Ihnen die größeren Sorgen?
David McAllister: Bei den Brexit-Verhandlungen drängt die Zeit mittlerweile enorm! Die Verhandlungen über den EU-Austritt des Vereinigten Königreichs müssen bis spätestens Ende Oktober/Anfang November abgeschlossen sein. Auf dem Weg dahin ist durch den Streit innerhalb der britischen Regierung bereits viel Zeit verloren worden.
WELT: Halten Sie die von Theresa May in ihrem Weißbuch vorgelegten Brexit-Pläne für einigungsfähig?
McAllister: Durch das am Donnerstag veröffentlichte Weißbuch zu den zukünftigen EU-UK-Beziehungen gibt es jetzt mehr Klarheit, was die britische Seite konkret anstrebt. Manches geht in die richtige Richtung. So haben wir im Europäischen Parlament seit Beginn der Verhandlungen ein Assoziierungsabkommen vorgeschlagen. Jetzt gilt es, das Dokument sehr sorgfältig auf Praxistauglichkeit zu prüfen und offene Punkte mit der britischen Seite zu klären. Das braucht Zeit.
WELT: Hat der Rücktritt von Außenminister Boris Johnson und Brexit-Minister David Davis die britische Regierungschefin nicht entscheidend geschwächt?
McAllister: Die Zukunft der Premierministerin entscheidet sich in der Unterhaus-Fraktion der Konservativen. Dass es dort bislang keinen Versuch gegeben hat, der Regierungschefin das Vertrauen zu entziehen, deutet darauf hin, dass sich ihre Position trotz dieser handfesten Regierungskrise momentan stabilisiert hat.
WELT: Was ist Boris Johnsons Kalkül? Will er Premierminister werden?
McAllister: Boris Johnsons Rücktrittsschreiben war ein bemerkenswertes Stück englischsprachiger Prosa. Er hat darin bildlich erklärt, warum er nicht bereit sei, die Kabinettsbeschlüsse von Chequers öffentlich zu vertreten. Insofern ist sein Rücktritt als „hard Brexiteer“ aus seiner Sicht konsequent. Wer Boris Johnson kennt, weiß, dass er ein sehr ambitionierter Politiker ist.
WELT: Nüchtern betrachtet: Was wäre für Deutschland die bessere Variante: der „Hard Brexit“, wie Johnson ihn vertritt, oder der „Soft Brexit“ Theresa Mays?
McAllister: Die beste Entscheidung für alle Beteiligten wäre, dass es gar keinen Brexit gibt und das Vereinigte Königreich Mitglied der Europäischen Union bleibt. Der Brexit ist ein historischer Fehler mit schwerwiegenden Konsequenzen für Großbritannien. Die zweitbeste Entscheidung wäre, wenn die Briten – wie Norwegen oder Island – im gemeinsamen Binnenmarkt blieben. Da die Regierung in London aber fest entschlossen ist, sowohl den Binnenmarkt als auch die Zollunion zu verlassen, fällt auch diese Option weg.
Deshalb läuft am Ende alles auf ein Freihandelsabkommen und eine Sicherheitspartnerschaft hinaus. Dazu könnten weitere einzelne Kooperationen, zum Beispiel bei der Forschungsförderung oder in der Bildungspolitik, kommen. Wir sollten eine möglichst enge Kooperation mit dem Vereinigten Königreich anstreben, aber unter Wahrung unserer bewährten Grundsätze der EU und des Binnenmarkts.
WELT: Was passiert, wenn es bis zum Stichtag Ende März 2019 keine Ausstiegsvereinbarung zwischen der EU und Großbritannien gibt?
McAllister: Der sogenannte No-Deal wäre für beide Seiten, für die Briten wie für die EU, das mit Abstand schlechteste Ergebnis. In diesem Fall würde Großbritannien am 29. März 2019 ohne eine Übergangsregelung automatisch aus der EU und aus dem Binnenmarkt ausscheiden. Es würden Zölle fällig werden, der gegenseitige Handel wäre dramatisch beeinträchtigt.
Das „Open-Sky-Abkommen“ würde nicht länger gelten, was bedeuten würde, dass britische Flugzeuge nicht mehr auf den Flughäfen in der EU landen dürften. Die Liste der weiteren Beispiele ist lang. Keine Vereinbarung zu erzielen, wäre ein Desaster, das jeder politisch Verantwortliche vermeiden sollte.
WELT: Woran hakt denn eine für beide Seiten annehmbare Ausstiegsvereinbarung?
McAllister: Das größte Problem ist und bleibt die irisch-nordirische Grenzfrage. Hier widersprechen sich drei Ziele britischer Politik. Man will zum einen die Zollunion verlassen, was zwangsläufig die Errichtung einer Zollaußengrenze zwischen Nordirland und Irland zur Folge hätte. Gleichzeitig soll unbedingt vermieden werden, dass genau diese Grenze entsteht. Dies würde aber ein einheitliches rechtliches Regelwerk bedeuten.
Das hingegen würde dazu führen, dass sich Nordirland und der Rest Großbritanniens mittelfristig regulatorisch auseinanderentwickeln könnten, was wiederum dem britischen Ziel widerspricht, die Einheit des Vereinigten Königreichs von England, Schottland, Wales und Nordirland zu wahren.
WELT: US-Präsident Trump hat Großbritannien nach dem Nato-Gipfel zu einem „Hard Brexit“ geraten. Welche Strategie verfolgen die USA mit solchen Empfehlungen?
McAllister: Welche Ziele Herr Trump mit solchen Äußerungen verfolgt, weiß ich nicht. Bei der Pressekonferenz im Anschluss an den Nato-Gipfel in Brüssel hat er gesagt, dass es ihm nicht zustehe, sich in die britische Innenpolitik einzumischen. Daran hätte er sich nach dem Gipfel halten sollen.
WELT: Trump hat beim Nato-Gipfel ohnehin sehr unterschiedliche Signale gesendet. Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Beziehungen zwischen der EU und den USA beschreiben?
McAllister: Der Auftritt des US-Präsidenten in Brüssel war einmal mehr irritierend. Der Rückzug der USA aus zahlreichen internationalen Vereinbarungen belastet die transatlantischen Beziehungen. Zumindest haben sich die USA im gemeinsamen Gipfelkommuniqué uneingeschränkt zu ihrer Bündnisverpflichtung bekannt.
WELT: Ist Trumps Forderung nach deutlich höheren Verteidigungsausgaben gerade der europäischen Nato-Partner – also von vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts – gerechtfertigt?
McAllister: Deutschland hat sich aufgrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage auf dem Nato-Gipfel in Wales 2014 verpflichtet, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der Deutsche Bundestag hat hier bereits eine deutliche Steigerung von 32 Milliarden im Jahr 2014 auf 42 Milliarden im Jahr 2021 eingeleitet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diese Woche erneut bekräftigt, am vereinbarten Ziel festzuhalten, bis 2024 die Verteidigungsausgaben in Richtung von zwei Prozent zu steigern. Eine Erhöhung auf vier Prozent wurde nicht beschlossen und ist auch nicht geboten.
WELT: Sie selbst befinden sich inzwischen ja zumindest geografisch in einer gewissen Äquidistanz zu Berlin und München. Wer hat in dem Konflikt zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik recht?
McAllister: Recht haben diejenigen, die die Migration nach Deutschland besser ordnen, steuern und begrenzen wollen. Das eint CDU und CSU. Dass in einem Punkt über zwei Wochen lang öffentlich und von einigen ungewöhnlich hart gestritten wurde, war nicht gut. Das darf sich nicht wiederholen. Für die Zukunft sollten wir daraus lernen, Meinungsverschiedenheiten intern auszutragen.
WELT: Und wer hat, Stand jetzt, gewonnen?
McAllister: Jetzt gilt es, auf der Basis der Vereinbarungen zwischen CDU und CSU sowie zwischen CDU/CSU und SPD vernünftige Politik zu machen: ordnen, steuern und begrenzen. Dafür brauchen wir gemeinsame Lösungen mit unseren europäischen Partnern. Daran arbeitet die Bundesregierung und besonders der fachlich zuständige Bundesinnenminister.
WELT: Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass die EU noch zu einer gemeinsamen Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik kommt?
McAllister: Es gibt Meinungsverschiedenheiten innerhalb der EU. Das gilt insbesondere bei der Frage der solidarischen Verteilung anerkannter Asylbewerber. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Gemeinsamkeiten: der Kampf gegen die Fluchtursachen, eine zielgerichtete Entwicklungspolitik, ein besserer Schutz unserer EU-Außengrenzen, die Einrichtung von Flüchtlingszentren außerhalb der EU sowie die konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber.
Auf diese Themen sollten wir uns konzentrieren. Dazu bieten die anstehenden Beratungen für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU die passende Gelegenheit.
WELT: Unterm Strich: Wer hält den derzeitigen politischen Turbulenzen länger stand? Theresa May oder Angela Merkel?
McAllister: Mein Wunsch ist, dass Angela Merkel für die gesamte Legislaturperiode als Bundeskanzlerin erfolgreich Politik für Deutschland und Europa gestaltet.