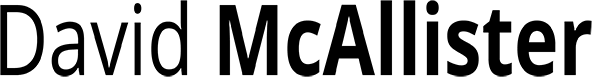Die Entscheidung : „Der Ball liegt eindeutig im britischen Spielfeld“
Ein Gespräch David McAllister, dem Vorsitzenden im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlamentes und CDU-Spitzenkandidat der vergangenen Europawahl über die Herausforderungen des Brexits, die Pläne des französischen Präsidenten für Europa und die Zukunft die Europäischen Union.
Herr McAllister, Sie waren dabei, als Emmanuel Macron seine Rede im Europäischen Parlament gehalten hat. Wie schätzen Sie seine Pläne ein?
Präsident Emmanuel Macron hat in Straßburg interessante Ideen präsentiert. Die Bundesregierung ist bereit, seine Vorschläge intensiv zu prüfen.
Die Europäische Union befindet sich jetzt in einer entscheidenden Phase, die vor allem durch internationale Machtverschiebungen, multiple Krisen, die Auswirkungen der Globalisierung und der Digitalisierung sowie dem drohenden Brexit gekennzeichnet ist. Die EU sollte sich nun auf wesentliche Aufgaben konzentrieren: die Wirtschafts- und Währungsunion vertiefen, den Binnenmarkt stärken, eine Digitalunion schaffen. Zudem benötigen wir einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen, eine gemeinsame Migrationspolitik sowie mehr Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir müssen rasch Ergebnisse präsentieren, um das Vertrauen der Menschen anlässlich der nächsten Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai 2019 zu gewinnen.
Teilen Sie die kritischen Einschätzungen seiner finanzpolitischen Pläne?
Es geht darum, unsere gemeinsame Währung dauerhaft zu stärken. Die Eurozone muss reformiert werden, um globalen Krisen besser standhalten zu können. Dabei ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt der Kompass. Die Verantwortung für Risiko und Haftung müssen einhergehen. Deshalb lehnen wir als CDU und CSU eine Vergemeinschaftung von Schulden konsequent ab. Bei der Frage, ob ein eigenständiges Eurozonenbudget wirklich weiterhilft, bin ich skeptisch. Nach dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs werden 85 Prozent des EU-Haushaltes sowieso von EU-Staaten getragen, die gleichzeitig Mitglied der Eurozone sind.
Ihr Vater war Schotte, Sie haben die britische Staatsbürgerschaft und sind regelmäßig in England und Schottland. Wie erleben Sie die Brexit-Diskussionen in ihrem Bekanntenkreis?
Zum Vereinigten Königreich habe ich vielfältige familiäre und politische Beziehungen und versuche, häufig auf der Insel zu sein. Der Referendums-Wahlkampf ist für britische Verhältnisse außergewöhnlich scharf geführt worden, mit persönlichen Attacken und Diffamierungen von Seiten der EU-Gegner. Er hat das politische und gesellschaftliche Klima im Land negativ verändert. Es gibt nach wie vor tiefe Gräben zwischen den Lagern – auch in privaten Runden spricht man das Thema besser nur behutsam an. Der Brexit dominiert bis heute die öffentliche Debatte im Vereinigten Königreich.
Wie sollten wir in Deutschland damit umgehen?
Den drohenden britischen EU-Austritt bedauere ich zutiefst. Das Vereinigte Königreich war in den mehr als 40 Jahren seiner EU-Mitgliedschaft kein einfacher Partner. Aber wenn es darum ging den Binnenmarkt zu stärken, kluge Freihandelsabkommen abzuschließen, die EU wettbewerbsfähiger zu machen oder unnötige Bürokratie abzubauen, waren die Briten wichtige Verbündete. Den Brexit halte ich für einen historischen Fehler. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass die britische Regierung fest entschlossen ist nicht nur die EU, sondern ebenso den Binnenmarkt und die Zollunion zu verlassen. Auch künftig sollten wir mit dem Vereinigten Königreich eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die Briten bleiben unsere wichtigen Verbündeten in NATO, G7, G20 und den Vereinten Nationen und ebenso ein bedeutender Handelspartner.
Die Haltung der britischen Regierung ist in den vergangenen Monaten widersprüchlich gewesen: Theresa May kündigte einen harten Brexit an, vereinbart wurde aber eine zweijährige Übergangsphase und erst vor wenigen Wochen ist im Oberhaus darüber abgestimmt worden, dass auch künftig eine Zollunion möglich sein kann. Wie erklären Sie sich das?
Die 21-monatige Übergangsphase ist sinnvoll, damit Wirtschaft und Bürger sich auf die Auswirkungen des Brexit vorbereiten können. Die andauernde Debatte auf der Insel zeigt aber auch, dass die Frage über die die britischen Bürger am 23. Juni 2016 abgestimmt haben, nicht präzise gestellt war. Im Referendum ging es um die Frage, ob das Vereinigte Königreich Teil der Europäischen Union bleiben soll oder nicht. Die einen haben darunter offenbar verstanden, dass die Mitgliedschaft in der EU eben auch den Binnenmarkt und die Zollunion umfasst. Während andere im Wahlkampf argumentiert haben, dass man die Europäische Union verlassen, aber gleichzeitig im Binnenmarkt eingebunden bleiben könne. So wie es bei Norwegen oder Island der Fall ist. Genau solche Fragen sind vor dem Referendum selbst nicht geklärt gewesen und das führt jetzt zu diesen politischen Kontroversen.
Das heißt, es ist eigentlich nicht klar, was im Referendum beschlossen wurde?
Genau. Es ist natürlich ein erheblicher Unterschied, ob man „nur“ die Europäische Union oder auch den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen möchte. Die Mitgliedschaft in der Zollunion ist auch deshalb so entscheidend, weil sie sehr eng mit der Frage der irisch-nordirischen Grenzen zusammenhängt. Drei Ziele der Regierung in London widersprechen sich: Zum einen will man Binnenmarkt und Zollunion verlassen. Das führt automatisch zur Errichtung einer wie auch immer gestalteten Zollaußengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Da man aber diese Grenze unter allen Umständen vermeiden will, böte sich an, dass Nordirland mit einem Sonderstatus Teil der Zollunion bleibt. Das hätte allerdings zur Folge, dass zwischen England, Wales und Schottland auf der einen und Nordirland auf der anderen Seite auch wieder eine Zollgrenze eingeführt werden müsste. Das wiederum steht dem Ziel entgegen, die politische Einheit aller vier Nationen des Vereinigten Königreichs zu garantieren. Dieser Widerspruch lässt sich nicht auflösen.
Würde das Vereinigte Königreich in der Zollunion bleiben, wäre zumindest die hochsensible irisch-nordirische Grenzfrage gelöst…
Ein Verbleib in der Zollunion bedeutet aber, dass Freihandelsabkommen mit anderen Teilen der Welt nicht vollkommen eigenständig abgeschlossen werden können. Das war ja ein zentrales Anliegen der „Brexiteers“. Diese selbstgeschaffenen Probleme müssen in London geklärt werden. Der Ball liegt eindeutig im britischen Spielfeld. Spätestens Ende Oktober müssen die Brexit-Verhandlungen abgeschlossen sein, damit das Vereinigte Königreich die EU Ende März 2019 wie geplant verlassen kann. Es bleibt jetzt weniger als ein halbes Jahr. Das ist alles sehr ambitioniert.
Die Junge Union wünscht sich im Bereich der gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik eine vertiefte Zusammenarbeit. Wolfgang Schäuble sagte auf eine JU-Veranstaltung im vergangenen Jahr, dass wir bis 2029 wahrscheinlich eine gemeinsame Europäische Armee hätten. Wie schätzen Sie das ein?
In der Außen- und Verteidigungspolitik sollten wir viel mehr europäisch zusammenarbeiten. Die Meinungsumfragen zeigen eindeutig, dass die große Mehrheit der Europäer genau dies fordert. Unser europäisches Prinzip war immer der Vorrang des Politischen vor dem Militärischen. Wir sind konzentriert auf Friedenssicherung, Entspannung und zivile Krisenprävention. Mehr Gemeinsamkeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bedeutet, den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO zu stärken. In den letzten zwei Jahren haben wir mehr Fortschritte erzielt, als in den 58 Jahren zuvor. Mit PESCO – der permanenten strukturierten Zusammenarbeit – werden erste Schritte hin zu einer Verteidigungsunion gemacht. In verschiedenen Projekten, von gemeinsamer Ausbildung für EU-Missionen über ein europäisches Sanitätskommando bis zu einer EU-Logistikdrehscheibe wird die Zusammenarbeit gestärkt. Durch Synergieeffekte werden Kosten gespart und die Einsatzfähigkeit verbessert. Der europäische Verteidigungsfonds bietet die Möglichkeit beim Thema Forschung und Beschaffung von Verteidigungsgütern besser zusammenzuarbeiten. Diesen Weg sollten wir konsequent weitergehen.
Wenn wir von einer gemeinsamen Außenpolitik sprechen: Wie könnte denn eine gemeinsame Außenpolitik aussehen? Frankreich und Großbritannien haben sich an den letzten Militärschlägen auf das syrische Chemiewaffenprogramm beispielsweise beteiligt, Deutschland und weitere EU- und NATO-Partner haben sich nicht beteiligt.
Der Konflikt in Syrien kann nur politisch gelöst werden. Die Europäische Union ist vor allem eine „Soft Power“: Unsere Strategie war und ist, zunächst einen Waffenstillstand zu erzielen. Die EU ist der mit Abstand größte Geldgeber in der Region. Wir haben bereits mehr als 10 Milliarden Euro an humanitärer Hilfe bereitgestellt. Nun geht es darum, einen politischen Prozess unter Beteiligung aller, die im Land und in der Region Einfluss haben zu starten. Am Ende müssen Neuwahlen stehen. Unser Ziel ist, ein demokratisches, friedliches und rechtsstaatliches Syrien, für alle Einwohner – egal welcher Religion oder Ethnie.
In einem Jahr wird ein neues europäisches Parlament gewählt. Das Parlament hat erklärt, man wolle am Spitzenkandidatenprinzip festhalten. Ist das realistisch? Wenn ja: Wer wird der Kandidat für die Unionsparteien?
2014 wurde mit Jean-Claude Juncker das erste Mal ein Kommissionspräsident gewählt der zuvor als Spitzenkandidat bei den Europawahlen angetreten war. Der Spitzenkandidatenprozess leistet einen Beitrag, um die Europäische Union demokratischer und transparenter zu gestalten. Bei jeder nationalen, regionalen oder lokalen Wahl weiß man in Deutschland schon vor der Wahl, wer sich für das Amt des Bundeskanzlers, Ministerpräsidenten oder Hauptverwaltungsbeamten bewirbt. Das ist doch eine demokratische Selbstverständlichkeit.
Und wer wird der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei?
Wir werden als Europäische Volkspartei unsere Spitzenkandidatin – oder unseren Spitzenkandidaten – auf einem Parteitag am 8. November in Helsinki wählen. Andere europäische Parteienfamilien haben ebenfalls angekündigt, Spitzenkandidaten zu nominieren. Der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, haben das Vorschlagrecht für das Amt des Kommissionspräsidenten. Im Anschluss muss ihn das Parlament jedoch mit absoluter Mehrheit wählen. Die Mehrheit der Fraktionen hat deutlich gemacht, dass im Europäischen Parlament nur ein Kandidat gewählt wird, der oder die sich vorher einem europäischen Wahlkampf als Spitzenkandidat gestellt hat.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für den Wahlkampf!
Besten Dank! Auf die weitere Zusammenarbeit mit der Jungen Union freue ich mich. Die JU hat über Jahrzehnte stets die Europapolitik unserer Partei entscheidend positiv mitgeprägt. Bleibt bitte am Ball!
Das Gespräch führte Moritz Mihm.