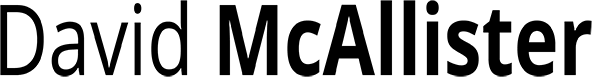Joint statement by leading MEPs on the reintroduction of the draft law on “Transparency of Foreign Influence” in Georgia. „We are deeply concerned by the re-introduction of the draft law on “Transparency of Foreign Influence” by the ruling party in Georgia. This law, which passed...
Read More
– Mehr als acht von zehn Europäerinnen und Europäern (81 %) sind der Meinung, dass Wählen angesichts der aktuellen geopolitischen Lage noch wichtiger ist (Deutschland: 87 %, Österreich: 79 %). -Sechs von zehn (60 %) interessieren sich für die bevorstehende Europawahl vom 6. bis 9....
Read More
Illegal migrant entries into the EU are at their highest since the migration crisis of 2015. In the first two months of 2024, the number of illegal border crossings reported reached 31,200, similar as the same period last year. (Frontex). This excludes Ukrainians who are...
Read More
CDU startet in Hildesheim mit Ursula von der Leyen in den Europawahlkampf Hildesheim. „Europa liefert – auch für Niedersachsen. Gemeinsam haben wir viel erreicht und große Herausforderungen bewältigt. Jetzt geht es darum, dass wir auch weiterhin gemeinsam an Lösungen für die Menschen in Europa arbeiten....
Read More
The Committee on Foreign Affairs will discuss the progress of EU reforms in Montenegro with Prime Minister Milojko Spajić on Tuesday. When: Tuesday, 16 April, from 16:00-to 17:00 Where: Brussels Room: SPINELLI (5G-2) and online You can follow the discussion live. Meeting agenda. FOLLOW US ON...
Read More
Parliament approved the conclusion of the long-delayed Samoa Agreement on the partnership between the EU and members of the Organisation of African, Caribbean, and Pacific States (OACPS). With 448 votes in favour, 31 against, and 131 abstentions, on Wednesday MEPs gave their consent to the...
Read More